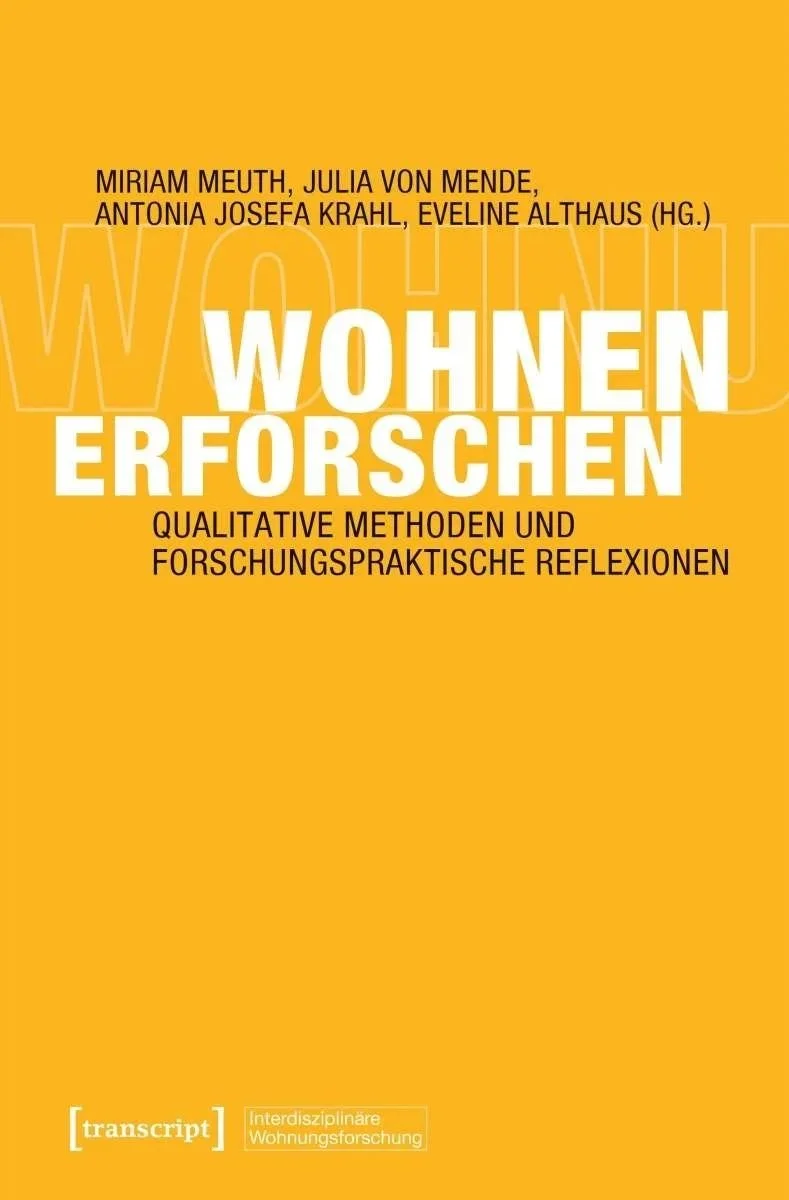Research Interests:
Methodological Research
Mixed Methods Research
Integrating Methods
Sociology of architetcure and housing
Urban Sociology
Scientific Memberships:
Mixed Methods International Research Association (MMIRA)
German Sociological Association (GSA)
Working Group Mixed Methods
Section Stadt- und RegionalsoziologieWeimarer Housing Research (Weimarer Wohnungsforschung)
Academy for Territorial Development in The Leibniz Association (ARL)
Research Projects:
Where do I want to live? – Understanding young adults' housing decision-making processes
What factors influence young adults' decisions on where to live in rural areas of Baden-Württemberg, and what patterns of orientation can be observed in their decisions?
Moving out of the family home, relocating for education or work, entering into partnerships, etc. shape the lives of young adults between the ages of 18 and 25 like no other phase of life – as does migration from rural areas. This raises the question of what factors influence decisions about where to live. What motivates young adults to move away or stay? What do they expect from moving away and what experiences do they have in a new region? When or under what circumstances would they come back or do they come back? What are the “pull” factors and what are the “push” factors?
The research project therefore focused on the questions of which factors influence the residential decisions of young adults in rural areas of Baden-Württemberg, which orientation patterns emerge in residential decisions, and which recommendations for action can be derived from this to increase the attractiveness of rural areas in Baden-Württemberg. To this end, eight group discussions with a total of 56 young adults were held at various locations in Baden-Württemberg between September 2023 and summer 2024, and three stakeholder workshops were conducted.
Based on group discussions with young adults, it became clear, for example, that decisions about where to live can be classified into the categories “staying,” “between staying and leaving,” and “returning.” This classification is the result of an interplay between three dimensions: (1) emotional and social ties to the place, (2) which factors are relevant to the decision on where to live in the current situation, and (3) how the circumstances found in the place are assessed. The different interactions between these dimensions can be described in the following six types:
Type 1: Those who stay naturally feel at home where they are and it goes without saying that they will remain there. However, the prospect of completing school or training could lead to a shift in priorities or necessities and result in them moving away.
Type 2: Those who stay intentionally have made a conscious decision to build a future where they are, weighing up the possible disadvantages. Their family and social resources in the area not only reinforce their decision, but also make it easier to put into practice.
Type 3: For those who stay involuntarily but want to move away, formal restrictions or precarious circumstances currently prevent them from doing so. Even if they view the area rather critically and lack social connections, they usually accept the situation.
Type 4: Income- and status-oriented, traditional (connected) residents feel closely connected to their home region, but are not willing to accept career-related restrictions. (Better) career opportunities in another location, including abroad, could therefore lead them to move away.
Type 5: Those who move between “different worlds” live elsewhere due to training or studies, but return to their home town regularly. In this way, they consciously combine the advantages of urban and rural life. Where they will end up in the long term is still open.
Type 6: The home-loving returnees have returned to the place with conviction after a period of discovery. The driving forces were their strong attachment to their homeland and their high appreciation for rural life.
Auszug aus dem Elternhaus, ausbildungs- und berufsbedingte Umzüge, Partnerschaften usw. prägen die Lebensphase junger Erwachsene zwischen 18 und etwa 25 Jahre wie keine andere – auch die Abwanderung aus ländlichen Regionen. Es stellt sich dementsprechend die Frage, welche Faktoren Wohnentscheidungen beeinflussen. Was motiviert junge Erwachsene wegzuziehen oder zu bleiben? Was erwarten sie vom Wegzug und welche Erfahrung machen sie in einer neuen Wohnregion? Wann oder unter welchen Umständen würden sie zurückkommen oder kommen sie zurück? Was sind eher „Pull“- und was eher „Push“-Faktoren?
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde daher die Fragen in den Fokus gerückt, welche Faktoren Wohnortentscheidungen junger Erwachsener in ländlichen Räumen Baden-Württembergs beeinflussen, welche Orientierungsmuster sich bei Wohnortentscheidungen zeigen und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für eine Erhöhung der Standortattraktivität ländlicher Räume Baden-Württembergs ergeben. Dazu wurden zwischen September 2023 und Sommer 2024 acht Gruppendiskussionen mit insgesamt 56 jungen Erwachsenen an unterschiedlichen baden-württembergischen Orten geführt sowie drei Stakeholder-Workshops durchgeführt.
Auf Basis der Gruppendiskussionen mit jungen Erwachsenen wurde beispielsweise deutlich, dass sich Wohnortentscheidungen in die Kategorien „Bleiben“, „Zwischen Bleiben und Gehen“ sowie „Rückkehren“ einordnen lassen. Dabei resultiert die Einordnung durch ein Zusammenspiel dreier Dimensionen: (1) die emotionale und soziale Eingebundenheit am Ort, (2) welche Faktoren in der aktuellen Situation für die Wohnortentscheidung relevant sind und (3) wie die vorgefundenen Begebenheiten am Ort bewertet werden. Dieses unterschiedliche Zusammenspiel dieser Dimensionen lassen sich in folgenden sechs Typen beschreiben:
Typ 1: Selbstverständlich Bleibende fühlen sich vor Ort wohl und es versteht sich für sie von selbst, auch dort zu bleiben. Der noch anstehende Schul- oder Ausbildungsabschluss etwa könnte aber dazu führen, dass sich Prioritäten bzw. Notwendigkeiten verschieben und es zum Wegzug kommt.
Typ 2: Intentional Bleibende haben sich bewusst für eine Zukunft am Ort entschieden und dabei auch mögliche Nachteile abgewogen. Ihre familiären und sozialen Ressourcen am Ort verstärken nicht nur die Entscheidung, sondern dürften auch die praktische Umsetzung erleichtern.
Typ 3: Für unfreiwillig Bleibende mit Wegzugsorientierung ist ein Umzug aufgrund formaler Restriktionen oder prekärer Umstände momentan ausgeschlossen. Auch wenn der Ort eher kritisch gesehen wird und es an sozialem Anschluss fehlt, wird die Situation aber meist akzeptiert.
Typ 4: Verdienst- und statusorientierte, traditionelle (Verbunden-)Bleibende fühlen sich zwar eng mit der Heimat verbunden, sind jedoch nicht bereit, karrierebezogene Einschränkungen in Kauf zu nehmen. (Bessere) berufliche Entwicklungschancen an einem anderen Ort, auch im Ausland, könnten also zum Wegzug führen.
Typ 5: Zwischen den Welten Wandelnde wohnen aufgrund von Ausbildung bzw. Studium woanders, kehren aber regelmäßig an den Ort zurück. Dadurch verbinden sie ganz bewusst die Vorzüge des Urbanen mit dem Ländlichen. Wohin es sie langfristig verschlägt, ist noch offen.
Typ 6: Die heimatverbundenen Rückkehrenden sind nach einer Phase des Entdeckens voller Überzeugung an den Ort zurückgezogen. Treiber waren die starke Heimatverbundenheit und die hohe Wertschätzung für das ländliche Leben.
Publications related to the topic:
Krahl, Antonia J./ Roßmann, Anna/ Tsipouras, Anna I./ Vogl, Susanne 2025: Wo will ich leben? Wohnortentscheidungen junger Erwachsener in ländlichen Räumen Baden-Württembergs.
Pooch, Marie-Theres/ Krahl, Antonia J./ Roßmann, Anna/ Freutel-Funke, Tabea/ Tsipouras, Anna/ Vogl, Susanne 2025: Wo will ich leben? Wohnortentscheidungen junger Erwachsener in ländlichen Räumen Baden-Württembergs. Abschlussbericht. Universität Stuttgart
Exploring Housing - Qualitative Methods and Practical Reflections on Research
How and by what methods can housing be scientifically researched?
How can housing be researched scientifically? For the first time in the German-speaking field, the authors bring together a variety of approaches to qualitative housing research. They gather perspectives from various disciplines in the humanities, social sciences, and engineering, and shed light on participatory and transformative, observational, visual, biographical-processual, and longitudinal research approaches, as well as mixed methods. A historical search for clues and comparative heuristics frame this kaleidoscope and serve as a rich source of inspiration for both novice and experienced researchers.
—
Wie kann Wohnen wissenschaftlich erforscht werden? Die Beiträger:innen bündeln erstmals im deutschsprachigen Raum eine Vielfalt an Zugängen der qualitativen Wohn(ungs)forschung. Dazu versammeln sie Perspektiven aus unterschiedlichen geistes-, sozial- und ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen und beleuchten partizipative bzw. transformative, beobachtende, visuelle, biografisch-prozessuale und longitudinale Forschungsansätze sowie Mixed Methods. Eine historische Spurensuche sowie vergleichende Heuristiken rahmen dieses Kaleidoskop und dienen sowohl angehenden wie auch erfahrenen Forscher:innen als reichhaltige Inspirationsquelle.
Publications related to the topic:
Meuth, Miriam/ Mende, Julia von/ Krahl, Antonia J./ Althaus, Eveline 2024: Wohnen erforschen. Qualitative Methoden und forschungspraktische Reflexionen. Bielefeld: transcript
Krahl, Antonia J. 2024: Mixed Methods Designs als Ansatz für die Wohn(ungs)forschung. Ein Plädoyer und Leitfaden. In: Meuth, Miriam/ Mende, Julia von/ Krahl, Antonia J./ Althaus, Eveline (Hrsg.): Wohnen erforschen. Qualitative Methoden und forschungspraktische Reflexionen. Bielefeld: transcript, 259-274
Open Access publiziert
Zugriff hier
Methods for researching Spatial-Material Aspects in Interaction with the Social
Methoden zur Erforschung räumlich-materieller Aspekte in Interaktion mit dem Sozialen
Since November 2020 I have been working with Prof. Dr. Julia von Mende on methods for researching spatial-material aspects in interaction with the social. In this context, we held the scientific workshop "Homes and their Tenants - Methods for Empirically Researching Housing Practices" on February 3rd, 2022 which brought together scientists from different disciplines. This workshop was part of the Weimarer Housing Research Workshop Series.
—
Seit November 2020 forsche ich zusammen mit meiner Kollegin Prof. Dr. Julia von Mende zu Methoden zur Erforschung räumlich-materieller Aspekte in Interaktion mit dem Sozialen. In diesem Zusammenhang führten wir am 03.02.2022 den wissenschaftlichen Workshop »Wohnungen und ihre Bewohner*innen – Methoden zur empirischen Erforschung von Wohnpraktiken« im Kontext der Weimarer Wohnungsforschung durch, der diese Frage aufgreifte und Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen zusammenführte.
Publications related to the topic:
Krahl, Antonia J. 2024: Mixed Methods Designs als Ansatz für die Wohn(ungs)forschung. Ein Plädoyer und Leitfaden. In: Meuth, Miriam/ Mende, Julia von/ Krahl, Antonia J./ Althaus, Eveline (Hrsg.): Wohnen erforschen. Qualitative Methoden und forschungspraktische Reflexionen. Bielefeld: transcript, 259-274
Meuth, Miriam/ Mende, Julia von/ Krahl, Antonia J./ Althaus, Eveline 2024: Wohnen erforschen. Qualitative Methoden und forschungspraktische Reflexionen. Bielefeld: transcript
Krahl, Antonia J. 2016: Architektursoziologie und ‘ihre’ Methoden. Ein metaanalytischer Zugang. In: Hannemann, Christine (Hrsg.): Materialien Architektur- und Wohnsoziologie, Universität Stuttgart, Fachgebiet Architektur- und Wohnsoziologie, Nr. 04
von Mende, Julia (2022): Zwischen Küche und Stadt. Zur Verräumlichung gegenwärtiger Essenspraktiken. Reihe: Materialität. Bielefeld: transcript
von Mende, Julia 2018: Kitchen Stories – mögliche Transformationen von Alltagsräumen am Beispiel der Ernährung. In: Förster, Marius/ Herbert, Saskia/ Hofmann, Mona/ Jonas, Wolfgang (Hrsg.): Un/Certain Futures – Rollen des Designs in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Bielefeld: transcript, 41-50
The Involvement of Housing Companies in the Provision of Affordable Housing: An exemplary analysis of the metropolitan regions of Munich and Stuttgart
Die Beteiligung von Wohnungsunternehmen an der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums: Eine exemplarische Analyse der Metropolregionen München und Stuttgart
In this study, I am researching the involvement of housing companies in the provision of affordable housing in an exemplary analysis of the metropolitan regions Munich and Stuttgart. In doing so, I make important contributions to current research on various levels: First, I analyze the actions of housing companies who have to act in the conflicting area of entrepreneurial logics on the one hand and common good-oriented logic on the other. Against this background, I am working on aspects that can positively influence the provision of affordable housing by housing companies. With the focus on the logic of action, I illuminate the role of the housing industry in providing affordable housing, which is hardly considered in Housing Research. Second, my research makes a contribution to the theoretical further development of sociological approaches within the Sociology of Housing. With the help of the elaborated research approach, the action decisions of economic actors (here, housing actors) on the basis of their institutional anchoring, social pressure to assume social responsibility and their expectations about future developments can be explained (Krahl 2020). Thirdly, I would like to make a contribution to “multimethod and mixed methods research (MMMR)” in order to be able to empirically research the research subject “provision of affordable housing by housing companies” in the most complex way possible and through different perspectives. In a first step, I built an extensive data set of the housing companies anchored in the two metropolitan regions. Using a standardized online questionnaire, I develop short profiles of actors that lead to a differentiated and detailed typology of housing companies in the field. Through this survey, I also realize the field access for the next empirical process which lead me to theory-led, partially standardized expert interviews. With the help of document analyzes, I embed the results from the expert interviews in the local housing policy context of the metropolitan region and, against this background, create detailed actor profiles that answer the question of the possibilities and obstacles of housing companies in the provision of affordable housing. With the help of two focus groups, different types of housing companies are invited to a group discussion based on a guide that is built from the results of the expert interviews. The aim is to examine which dynamics are developing and whether individual housing companies may set priorities differently or whether arguments even shift in the course of the group discussion.
Publications related to the topic:
Krahl, Antonia J. 2020: Handlungslogiken wohnungswirtschaftlicher Akteure als Schlüssel zur Sicherung sozialer Wohnraumversorgung. Eine soziologische Perspektive. In: Schönig, Barbara/ Vollmer, Lisa (Hrsg.): Wohnungsfragen ohne Ende?! Ressourcen für eine soziale Wohnraumversorgung. Bielefeld: transcript, 97-112
In dieser Studie erforsche ich die Beteiligung von Wohnungsunternehmen an der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in einer exemplarischen Analyse der Metropolregionen München und Stuttgart. Dabei leiste ich auf verschiedenen Ebenen wichtige Beiträge zur aktuellen Forschung: Erstens analysiere ich Handlungen wohnungswirtschaftlicher Akteure, die im Spannungsfeld unternehmerischer Logiken einerseits und gemeinwohlorientierter Logiken andererseits agieren müssen. Vor diesem Hintergrund erarbeite ich Aspekte, die eine Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums durch Wohnungsunternehmen positiv beeinflussen können. Mit diesem Blick auf die Handlungslogiken erhelle ich die in der Wohnungsforschung kaum beachtete Rolle der Wohnungswirtschaft bei der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums. Zweitens leistet meine Forschung einen Beitrag zur theoretischen Weiterentwicklung soziologischer Ansätze innerhalb der Wohnungsforschung, die Handlungsentscheidungen von Wirtschaftsakteuren (hier wohnungswirtschaftliche Akteure) auf Grundlage ihrer institutionellen Verankerung, des gesellschaftlichen Drucks zu sozialer Verantwortungsübernahme sowie deren Erwartungen über zukünftige Entwicklungen, erklären (Krahl 2020). Drittens möchte ich mit meiner Dissertation einen Beitrag zum „multimethod and mixed methods research (MMMR)“ leisten, um den Forschungsgegenstand „Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums durch Wohnungsunternehmen“ in möglichst komplexer Weise und durch unterschiedliche Perspektiven empirisch erforschen zu können. In einem ersten Schritt recherchiere und erstelle ich dazu einen umfangreichen Datensatz der in den beiden Metropolregionen verankerten wohnungswirtschaftlichen Akteure. Über einen standardisierten Onlinefragebogen erarbeite ich Akteurs-Kurzprofile, die zu einer Typologisierung wohnungswirtschaftlicher Akteure im Feld führen. Beides ist im wohnungswissenschaftlichen Diskurs nicht vorhanden, womit ich bereits hier eine Forschungslücke schließen kann. Über diese Erhebung realisiere ich auch den Feldzugang für den nächsten empirischen Erhebungsprozess, den ich mit theoriegeleiteten teilstandardisierten Expert*inneninterviews umsetze. Mithilfe von Dokumentenanalysen bette ich die Ergebnisse aus den Expert*inneninterviews in den jeweils wohnungspolitischen Kontext der Metropolregion ein und erstelle vor diesem Hintergrund ausführliche Akteurs-Profile, die die Frage nach Möglichkeiten und Hindernissen privatwirtschaftlicher Akteure bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, beantworten. Mithilfe zweier Fokusgruppen werden verschiedene Typen wohnungswirtschaftlicher Akteure basierend auf einem aus den Expert*inneninterviews informierten Leitfaden zur einer Gruppendiskussion eingeladen. Ziel ist es zu prüfen, welche Dynamiken sich entwickeln und ob ggf. einzelne wohnungswirtschaftliche Akteure Schwerpunktsetzungen vornehmen oder ob sich gar im Verlauf der Gruppendiskussion Argumentationen verschieben.
The Sociology of Architecture and 'its' methods. A meta-analysis
Architektursoziologie und ‘ihre’ Methoden. Ein metaanalytischer Zugang
The main focus of this research was the ‚sociology of architecture’ and ‚its’ methods. On the one hand, the underlying interest can be described in systematizing the various range of subjects which a sociology of architecture unfurls. On the other hand, linked to the necessity in conceptualizing research projects in an elaborate way, the methodological approach was analysed. As a first step, interests and tasks were derived retrospectively and theoretically. This was realized by compiling and analysing scripts, publications and discourses. Those unfurled a debate concerning sociology of architecture, because there are always publications and discourses in each particular topic of the complex framework ‚sociology’, which were written prior to its actual establishment as an independent research area. Conseqently, five types of different topics could be indentified and described which are apparently linked to a sociology of architecture (1st iteration). Afterwards definitions of a sociology of architecture which were implemented in the Scientific Community were analysed in a second iteration. Subsequently, the substantial elements identified from this analysis were linked to the five previously developed types (2nd iteration). With a feedback loop to iteration 1, two more types of a sociology of architecture were identified, which were at that point also enriched with substantial content. Out of all implemented scientific definitions, the one which covered all seven identified types was chosen as the starting point in regard to this work. The system of categories for the structuring content analysis – concerning the first research question – arose from the theoretically derived types. In a last iteration, the typology was conclusively completed by implementing one more type (3rd iteration). The final typology included the following: ‚user perspective’, ‚power and dominion’, ‚transition’, ‚development of architectural profession’, ‚architecture as a process’, ‚participation’ and ‚sociological-action/ social-psychological perspective’. The latter is subdivided into the following four types ‚identitiy’, ‚frame’, ‚social representations’, and ‚social processes’.
The second research focussed on the methods of a sociology of architecture. In fact, a sociology of architecture is able to draw on an obsolent pool of theoretical elements but just on an initial pool of methodological tools (cf. Delitz 2009: 5ff.). Therefore, a further analysis of methods was necessary. Thus, the empirical data were analysed in regard to the applied methods and refered back to the eight identified types.
Publications related to the topic:
Krahl, Antonia J. 2016: Architektursoziologie und ‘ihre’ Methoden. Ein metaanalytischer Zugang. In: Hannemann, Christine (Hrsg.): Materialien Architektur- und Wohnsoziologie, Universität Stuttgart, Fachgebiet Architektur- und Wohnsoziologie, Nr. 04
Krahl, Antonia J. 2019: Rezension zu: Müller, Anna Lisa/ Reichmann, Werner, Architecture, Materiality and Society. Connecting Sociology of Architecture with Science and Technology Studies (2015). In: Werhahn, Rainer/ Wohlan, Jörg/ Hannemann, Christine/ Othengrafen, Frank/ Schmidt-Lauber, Brigitta (Hrsg.): Housing and Housing Politics in European Metropole. Jahrbuch StadtRegion 2017/2018. Wiesbaden: Springer
Inhaltlicher Schwerpunkt für das Konzept dieser Studie lag erstens in der Architektursoziologie und zweitens in deren Methoden. Rückt man diese ins Zentrum des Interesses kann leicht festgestellt werden, dass es sich um eine noch sehr junge Disziplin handelt, die sich neben den großen Theorie-Klassikern auch in der Speziellen Soziologie in Deutschland zunächst nicht etablieren konnte (vgl. Schäfers 2014: 11). Dabei fragt die Stadtsoziologie nach der „[...] empirischen und theoretischen Erforschung des sozialen Verhaltens, also der Untersuchung von Voraussetzungen, Abläufen und Folgen des Zusammenlebens von Menschen“ (Hannemann 2013: 64). Wohingegen die Wohnsoziologie analysiert „[...] wer die Bewohner sind, was sie tun, wenn sie wohnen, wie sie es tun und welchen Sinn sie dem beimessen“ (Häußermann/ Siebel 1996: 11). Die Kultursoziologie etikettiert Architektur als etwas der Technik zu nahes und die Techniksoziologie argumentiert, Architektur sei zu ästhetisch (vgl. Delitz 2009: 11). De facto: „[...] Die Architektur fiel bisher durch die Ritzen soziologischer Beobachtung“ (ebd.: 11). Doch die Relevanz einer solchen Disziplin für die Soziologie wird durch folgendes Paradoxon offensichtlich: Architektur ist “omnipräsent” (vgl. Schäfers 2004: 35) - eine „unentrinnbare, stets vor Augen stehende, nicht wegzustoßende, dauerhafte und überdimensionale Gestalt der Gesellschaft“ (Ebner et al. 2009: 11). Eine Verknüpfung von Architektur und Gesellschaft ist demnach unabdingbar. Wenn jedoch keine explizite, eigenständige ‚Theorie der Architektursoziologie’ von Soziologen in die Scientific Community implementiert wurde, so haben doch ‚große’ Soziologen auf eine solche Disziplin Bezug genommen, wie dies beispielsweise Georg Simmel bereits mit der „Soziologischen Ästhetik“ 1896 und den beiden Abhandlungen über „Die Großstädte und das Geistesleben“ 1903 sowie über „Das Problem des Stils“ 1908 getan hat. Neben Georg Simmel sind dazu aber auch Émile Durkheim (Morphologie sociale), Norbert Elias (über den Prozess der Zivilisation), Jürgen Habermas (Moderne und Architektur), James Coleman (Zur Definition der Situation), Michel Foucault (Raum, Wissen, Macht), Theodor Adorno (Funktionalismus heute) sowie Pierre Bourdieu (Die feinen Unterschiede) zu zählen, die jeweils in ihren Schriften indirekt Bezug auf eine Soziologie der Architektur genommen haben. Einer solchen theoretisch-konzeptionellen Grundlage der Architektursoziologie stehen Methoden der Architektursoziologie als spezifische empirische Konzeptualisierung und Umsetzung bezüglich relevanter Forschungsfragen gegenüber. Der Betrachtungsgegenstand ‚Architektur’ mit seiner Charakteristika aus Materialität, Nichtsprachlichkeit und einem fortlaufenden Bezug zu Körpern (vgl. Delitz 2010: 13), bildet die Herausforderung eines Zusammenführens von Architektur und Soziologie im Hinblick auf Methoden einer Architektursoziologie. (Vgl. Delitz 2009). „Die Architektur jeder Gesellschaft [...] umgibt die Einzelnen ständig: ist unentrinnbar, sozialisiert immer schon und bleibt dabei zumeist unbewusst. Sie verleiht der Gesellschaft zugleich stets eine bestimmte, sicht- und greifbare Gestalt: gliedert sie, affiziert die Einzelnen, verschafft den Institutionen Ausstrahlungskraft“ (Delitz 2009: 12). Darin liegt die Relevanz dieser Arbeit begründet – im Erarbeiten eines Überblicks der Methoden über eine vorherige Typologisierung der Fragestellungen einer Architektursoziologie, als Notwendigkeit für zukünftige, konkrete sowie empirisch-soziologische Analysen der Architektur. In einem ersten Schritt geht es darum, über einen theoretischen und gleichzeitig retrospektiven Blickwinkel ein Aufgaben- und Interessenprofil des Betrachtungsgegenstandes ‚Architektursoziologie’ zu erarbeiten (Iterationsschritt I), ihn in einem zweiten Schritt definitorisch zu fassen (Iteraitonsschritt II) und in einer Rückkopplungsschleife auf den ersten Iterationsschritt zu beziehen.